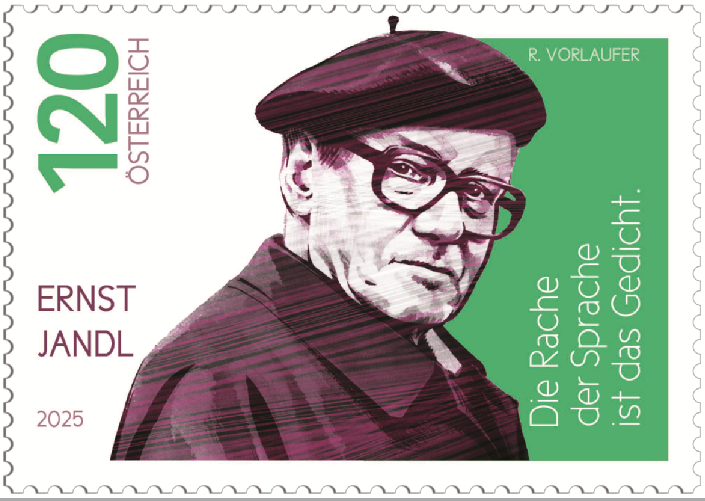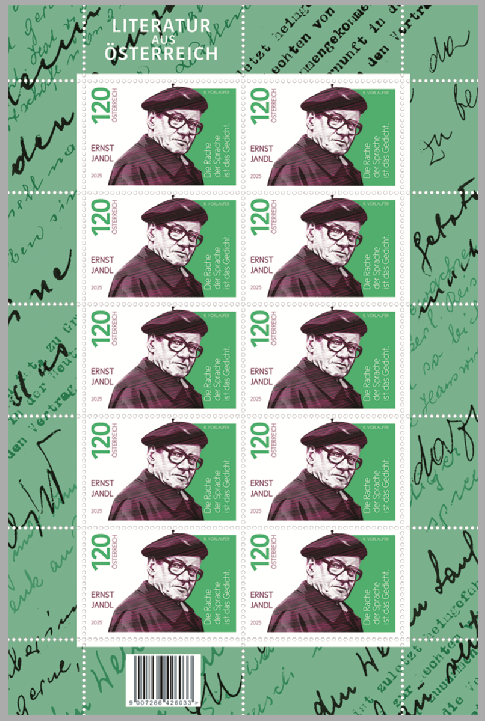Die zweite Ausgabe der 2023 gestarteten Serie „Sport in Bewegung“ ist diesmal den vielfältigen Sportarten auf dem Eis gewidmet.
Beim Eisstockschießen geht es darum, das Ziel – die Daube – möglichst genau zu treffen. Stöcke der gegnerischen Mannschaft dürfen dabei weggestoßen werden. Punkte bekommt die Mannschaft, deren Eisstöcke der Daube am nächsten sind. Alternativ gibt es auch Ziel- und Weitenwettbewerbe. Eisstockschießen ist vor allem im Alpenraum weit verbreitet. Es ist nicht nur eine Vereinssportart, sondern auch eine beliebte Freizeitaktivität, bei der es vor allem um den Spaß geht und meist weniger strenge Regeln gelten. Oft wird es auch auf gefrorenen Seen oder auf Kunststoffbahnen gespielt. In ländlichen Regionen kommen häufig selbst hergestellte Eisstöcke zum Einsatz.
Eine sehr schnelle, körperbetonte Mannschaftssportart ist Eishockey. Spiele, bei denen ein Ball mit Schlägern auf dem Eis bewegt wird, sind bereits auf niederländischen Gemälden aus dem 17. Jahrhundert dargestellt. Das moderne Eishockey entwickelte sich jedoch im 19. Jahrhundert im Zuge der Kolonialisierung durch europäische Soldaten in Kanada, wo es bis heute Nationalsport ist. Seit 1877 wird mit einem flachen Puck anstelle des Balls gespielt. Ein Spiel dauert dreimal 20 Minuten, durch häufige Unterbrechungen aber tatsächlich deutlich länger. Der rasante Spielverlauf und viele Tore machen Eishockey zu einem besonders spektakulären Sport.
Im Gegensatz dazu steht beim Eiskunstlauf die Anmut der Bewegungen im Vordergrund. Während sich Menschen schon in der Jungsteinzeit auf Gleitschuhen aus Knochen auf dem Eis fortbewegten, wurde Eislaufen in der Neuzeit zum gesellschaftlichen Vergnügen. Eislaufstiefel mit angeschraubten Stahlkufen ermöglichten ab dem späteren 19. Jahrhundert auch die Ausführung von Figuren, Drehungen und Sprüngen. Heute gibt es Wettbewerbe für Herren, Damen und Paare, Einzelläufe, Paarläufe sowie Eistanz, bei dem keine Sprünge gestattet sind. Eislaufen und Eistanzen sind natürlich auch beliebte Freizeitsportarten, bei denen man je nach Können mehr oder weniger elegant über das Eis gleiten kann.