Briefmarken / Auf deutsch » Deutsches Briefmarken / Mai 2024















Ôîðóì ôèëàòåëèñòîâ (Òåìàòè÷åñêàÿ ôèëàòåëèÿ è Ìèð) ÔÈËÔÎÐÓÌ |
Ïðèâåò, Ãîñòü! Âîéäèòå èëè çàðåãèñòðèðóéòåñü.
Âû çäåñü » Ôîðóì ôèëàòåëèñòîâ (Òåìàòè÷åñêàÿ ôèëàòåëèÿ è Ìèð) ÔÈËÔÎÐÓÌ » Briefmarken / Auf deutsch » Deutsches Briefmarken
Briefmarken / Auf deutsch » Deutsches Briefmarken / Mai 2024















125. Geburtstag Lotte Reiniger

Lotte Reiniger ist die Filmpionierin des 20. Jahrhunderts. Sie prägte die Entwicklung des Animationsfilms noch vor den Erfolgen von Walt Disney: Bereits 1919 nimmt sie ihren ersten Kurzfilm auf und stellt 1926 den ersten abendfüllenden Animationsfilm der Weltgeschichte „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“ fertig. Bis 1980 entsteht ein Oeuvre von über 60 Filmen. Neben Musik und Oper fokussiert sie dabei auf die Themen Mythologie und Märchen.
Reiniger wird 1899 in Berlin geboren und wächst in einem bürgerlichen Haushalt auf. Der frühe Kontakt zum Schauspieler und Filmregisseur Paul Wegener bringt sie an das Deutsche Theater, wo sie Schauspielunterricht nimmt. Im neu gegründeten Institut für Kulturforschung entwickelt sie gemeinsam mit ihrem späteren Ehemann Carl Koch den Tricktisch, auf dem sie ihre Figuren aus Pappe bewegt und jeden einzelnen Bewegungsschritt abfotografiert – für einen Film sind 24 Aufnahmen pro Sekunde nötig.
Aber nicht nur im Film schafft Lotte Reiniger Bahnbrechendes. Den Scherenschnitt entwickelt sie vom bloßen Umrissschnitt zu aufwändig gestalteten Kompositionen. Höhepunkt ihrer Scherenschnittkunst sind vier umfangreiche Folgen zu Mozartopern aus dem Jahr 1971. Schließlich setzt sie ihre ausgeschnittenen Figuren auch im Theater ein: Nach dem Vorbild des orientalischen Straßentheaters führt sie zahlreiche Stücke auf und prägt damit das moderne europäische Schattentheater entscheidend.
Während des Nationalsozialismus arbeitet das Ehepaar Reiniger-Koch in London, Paris und Rom und zieht nach einem vierjährigen Aufenthalt in Berlin endgültig nach London. Zurückgezogen stirbt Lotte Reiniger 1981.
Das Stadtmuseum Tübingen verwahrt ihren künstlerischen Nachlass und präsentiert einen Querschnitt ihres Schaffens in der Ausstellung: „Die Welt in Licht und Schatten“.
Gestaltung des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel: Laucke Siebein GbR, Offenbach am Main
Motiv: „Aschenputtel“, Lotte Reiniger, Scherenschnitt 1922 © VG Bild-Kunst, Bonn 2023
Wert: 160 Cent
Text: Dr. Evamarie Blattner, stellvertretende Leitung, Stadtmuseum Tübingen
200 Jahre deutsche Einwanderung in Brasilien

Deutschland und Brasilien verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Was sich heute durch intensive Handelsbeziehungen oder beispielsweise die gemeinsame Liebe zum Fußball darstellen lässt, hat eine Basis durch die vor 200 Jahren begonnene Einwanderung. Vor allem wirtschaftliche Gründe führten im 19. Jahrhundert zu einem Weggang vieler Deutscher nach Südamerika.
Angestoßen wurde die Auswanderung von Kaiser Dom Pedro I. und seiner Frau Leopoldina. Dabei erhoffte man sich neben der Gewinnung von Arbeitskräften auch einen Zugang zu technischem Sachverstand. Im Juli und November 1824 erreichten die ersten 120 Deutschen ihre künftige Heimat. Sie mussten sich an eine fremde Umgebung, andere klimatische Verhältnisse und neue Nachbarn gewöhnen. Gleichzeitig erhofften sie für sich ein besseres Leben und stabile politische Verhältnisse.
Nach einer langen Schiffsreise unter meist schlechten hygienischen Bedingungen fingen die Einwanderer an, in Brasilien Häuser zu bauen, Landwirtschaft zu betreiben oder Handwerksbetriebe zu gründen. Trotz unzureichender medizinischer Versorgung waren die Deutschen erfolgreich bei der Bearbeitung des Landes und konnten sich wirtschaftlich behaupten. Zudem brachten sie ihre kulturellen Gewohnheiten und religiösen Vorstellungen mit nach Brasilien und organisierten sich in Vereinen, Verbänden und Gemeinden.
Bis zur Jahrhundertwende folgten den ersten Einwanderern noch gut 90.000 Deutsche. Sie kamen vielfach vor allem aus Süd- und Ostdeutschland und ließen sich vor allem im Süden Brasiliens nieder. Orte wie São Leopoldo oder Novo Hamburgo im Bundesstaat Rio Grande do Sul oder Joinville und Blumenau in Santa Catarina oder Petrópolis weiter nördlich waren damals die bevorzugten Regionen deutscher Einwanderung. Bis in die 1950er Jahre wanderten weitere etwa 223.000 Deutsche aus. Heute haben etwa zehn Prozent der Brasilianerinnen und Brasilianer deutsche Vorfahren, angeblich sprechen mehr als eine Million Menschen die deutsche Sprache. Der 25. Juli als Ankunftstag der ersten deutschen Einwanderer in São Leopoldo wird als „Tag der deutschen Einwanderung“ in vielen Teilen Brasiliens begangen.
Gestaltung des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel: Prof. Jenny del Corte Hirschfeld, Frankfurt am Main
Wert: 110 Cent
Text: Walter Bernatek und Reinhard Küchler, Bund Deutscher Philatelisten e. V.
UEFA Fußball-Europameisterschaft 2024

Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 findet die UEFA EURO 2024tm in Deutschland statt. Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung ist die Bundesrepublik damit Ausrichter einer Fußball-Europameisterschaft. In den zehn Host Cities Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart ermitteln 24 Nationalteams den Gewinner der Henri-Delaunay-Trophäe, die im Zentrum der Briefmarke steht.
Das Turnier trägt das Motto „United by football. Vereint im Herzen Europas.“ und markiert die 17. Ausrichtung des 1960 von der Union der europäischen Fußball-Verbände (UEFA) gegründeten Wettbewerbs. Das Motto unterstreicht eine Botschaft von Einigkeit, Zusammengehörigkeit und Inklusion. Es ist derselbe Slogan, der auch bei der erfolgreichen Bewerbung des DFB und der Bundesregierung im Jahr 2018 verwendet wurde.
Der Blickfang der Marke ist die begehrte Henri-Delaunay-Trophäe. Sie wird eingerahmt von den Farben der UEFA-Mitgliedsverbände, die auf dem offiziellen Logo in 24 Felder eingeteilt sind und die 24 Teilnehmerländer symbolisieren. Gemeinsam bilden sie das Dach eines Stadions, angelehnt an das Berliner Olympiastadion, wo am 14. Juli 2024 das Finale der UEFA EURO 2024tm ausgespielt wird. Die Marke erlaubt schon vor dem Turnier einen Blick in das Stadion und weckt Vorfreude bei den Betrachterinnen und Betrachtern.
Die farbigen Balken der Marke bilden zudem weitere Elemente aus dem Fußball ab: Die gekreuzten Linien symbolisieren das Netz eines Tores, die breiten parallelen Linien einen frisch gemähten Rasen. Die groß gepunkteten Bereiche kopieren das traditionelle Muster des Balls als Spielgerät und die klein gepunkteten Bereiche das Konfetti, das während der Siegesfeier auf die Gewinnermannschaft herabschwebt.
Die Marke wirbt für eine EURO, bei der gemeinsam Diversität gefeiert wird und sich jeder willkommen fühlt. Die Bestandteile der Marke symbolisieren die bunte Vielfalt der Fans des europäischen Fußballs, die während der UEFA EURO 2024tm in Deutschland ein Zuhause erhalten.
Gestaltung des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel: Thomas Serres, Hattingen
© UEFA 2022
Wert: 85 Cent
Text: Max Geis, EURO 2024 GmbH
„Beliebte Urlaubsziele der Deutschen“ - Sylt

Kaum eine andere Region bietet so viel Abwechslung wie Deutschlands nördlichste Insel. Von traditionellen altfriesischen Häusern bis hin zu Luxushotels, vom erlebnisreichen Familienurlaub bis hin zum einsamen Strandspaziergang in Begleitung des Vierbeiners erfüllt die größte deutsche Nordseeinsel vor der Küste Schleswig-Holsteins und Dänemarks individuelle Herzenswünsche. Kein Wunder also, dass Sylt zu den beliebten Urlaubszielen der Deutschen gehört und als Motiv die gleichnamige Sonderpostwertzeichen-Serie einläutet, welche künftig jene Orte vorstellen wird, die wir in der freien Zeit des Jahres besonders gern und oft besuchen.
Als Heimat vieler seltener Tier- und Pflanzenarten steht die Hälfte der rund einhundert Quadratkilometer großen Insel unter Landschafts- und Naturschutz. Stark bedroht sind die für Sylt so typischen Heidelandschaften. Schutzgebiete wurden unter anderem für die hier lebenden Seevögel sowie die rastenden Zugvogelschwärme eingerichtet, ebenso für Schweinswale, die nahezu paradiesische Bedingungen vorfinden. Größere Populationen von Seehunden und Kegelrobben fühlen sich auf Sylt ebenfalls wohl und lassen sich auf den vorgelagerten Sandbänken die Sonne auf den Bauch scheinen.
An dem fast vierzig Kilometer langen Sandstrand können es sich auch die menschlichen Gäste in einem der Strandkörbe gemütlich machen. Wer mehr Bewegung braucht, kann zu Fuß durch das Watt und die Dünen wandern oder mit dem Fahrrad die Insel erkunden. Bekannt ist sie zudem als Wassersportrevier – nicht umsonst gilt Sylt als Geburtsort der deutschen Surfkultur. Abseits des Sommers bleibt Zeit für Wellness, Teestuben oder Spaziergänge zum Roten Kliff, dem Wahrzeichen der Insel. Auch Kinder kommen auf ihre Kosten: Für Spaß sorgen diverse Erlebniszentren oder das Wellenbad in der Hauptstadt Westerland. Zu den Attraktionen zählen außerdem kulturelle Einrichtungen und öffentliche Events. Diese spezielle Mischung aus Erholung und Erlebnis macht Sylt zu einem ganz besonderen Urlaubsziel.
Gestaltung des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel: powerbrand marketing, Aaliyah Pauler, Wiesbaden
Foto: © Svenlehenberger/Wirestock / Adobe Stock
Wert: 85 Cent
Text: Deutscher Philatelie Service, Wermsdorf
„Historische Bauwerke in Deutschland“ - Kölner Dom

Die zweite Briefmarke der Sonderpostwertzeichen-Serie „Historische Bauwerke in Deutschland“ zeigt den im Herzen der rheinischen Metropole gelegenen, beinahe achthundert Jahre alten Kölner Dom. Wie es für alle Marken dieser Serie geplant ist, war auch hier eine Künstliche Intelligenz (KI) an der Gestaltung des Motivs beteiligt. Und genauso wie „Brandenburger Tor“, die im November 2023 verausgabte erste Marke, erscheint auch die vorliegende überdies als Krypto-Briefmarke – das ist eine Kombination aus dem traditionellen, physischen Produkt und einem „digitalen Zwilling“ in einer Blockchain.
Durch den Besitz der Gebeine, die als Reliquien der Heiligen Drei Könige angesehen werden, entwickelte sich Köln ab 1164 zu einem der meistbesuchten Pilgerorte in Europa. Dies veranlasste die Errichtung einer gotischen Kathedrale, die alle bisherigen Kirchengebäude in den Schatten stellen sollte. Nach der Grundsteinlegung 1248 erstreckten sich die Bauarbeiten, mit einer Unterbrechung von fast dreihundert Jahren, bis zur Fertigstellung des Kölner Doms im Jahr 1880. Und auch heute sieht man das Wahrzeichen der Stadt, das 1996 in die Liste der UNESCO-Weltkulturerbestätten aufgenommen wurde, fast nie ohne Baugerüst, weil ständig Ausbesserungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen.
Der Kölner Dom ist auf unzähligen Abbildungen und zahlreichen Gemälden verewigt. Das Motiv der Briefmarke zeigt, wie eine Künstliche Intelligenz, die auf die Erstellung von Bildern und Zeichnungen spezialisiert ist, das weltberühmte Bauwerk interpretiert. Auf der Grundlage spezifischer Befehle und näherer Beschreibungen dessen, was zu sehen sein soll, erstellt das Programm, das die benötigten Informationen aus dem World Wide Web bezieht, mehrere Entwürfe. Diese kann die Nutzerin beziehungsweise der Nutzer nach Belieben weiter ausgestalten. Die Grafikerin oder der Grafiker behält mithin immer das letzte Wort, „den letzten Klick“ bei der Bearbeitung des Motivs.
Gestaltung des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel: Jan-Niklas Kröger, Bonn
Motiv: Kölner Dom: DALL-E
Ziffern Nominal: © ConstantinVonavi/shutterstock.com
Wert: 100 Cent
Text: Deutscher Philatelie Service, Wermsdorf
„Helden der Kindheit“

Das Sams und Michel aus Lönneberga
Autorinnen und Autoren von Kinderbüchern schöpfen zumeist aus ihrer eigenen Jugend. Während die einen Welten kreieren, in denen sie gern leben würden, erzählen die anderen von der Idylle, in der sie selbst aufgewachsen sind. Genau so verhält es sich bei dem deutschen Schriftsteller Paul Maar sowie der schwedischen Autorin Astrid Lindgren. Deren Werke „Eine Woche voller Samstage“ (1973) und „Michel in der Suppenschüssel“ (1964), die im Verlag Friedrich Oetinger erschienen sind, begeistern noch heute Groß und Klein gleichermaßen. Dies macht „Das Sams“ und „Michel aus Lönneberga“ zu idealen Motiven, um die beliebte Sonderpostwertzeichen-Serie „Helden der Kindheit“ fortzuführen.
Beide gehören zu den Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur. In mehr als fünfzig Sprachen wurden Michels Abenteuer übersetzt, was beim Sams aufgrund der vielen Wortspiele dagegen nicht so einfach ist. Beide aber feiern über ihre Bücher hinaus Erfolge in Film und Fernsehen und senden als Identifikationsfiguren für Jung und Alt wichtige Botschaften: Sei selbstbewusst und steh für deine Werte ein.
Gestaltung des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel: Jan-Niklas Kröger, Bonn
Motive: Das Sams: © 2024 Verlag Friedrich Oetinger / Paul Maar
Michel aus Lönneberga: © The Astrid Lindgren CompanyTM / Bildmakarna Berg AB / Björn Berg
Wert: 85 Cent + 85 Cent
Text: Deutscher Philatelie Service, Wermsdorf
„Leuchttürme“ - Alte Weser

Der Leuchtturm „Alte Weser“ liegt im Seegebiet der Deutschen Bucht, rund drei Kilometer vom heute nicht mehr aktiven Leuchtturm „Rotersand“ entfernt, auf Position 53°51,80´N und 008°07,65´E, bei Weser-km 111,5. Bremerhaven ist ca. 47 Kilometer entfernt, Helgoland rund 40 Kilometer.
1959 wurde der Bau des Leuchtturms „Alte Weser“ als Ersatz für den historischen Leuchtturm "Rotersand" vom damaligen „Wasser- und Schifffahrtsamt Bremerhaven“ beauftragt und am 1. September 1964 in Betrieb genommen.
Die leuchtfeuertechnische Anlage hat eine doppelte Gürteloptik mit einer 424.000 cd, Xenon Lichtquelle. Die Feuerhöhen über dem Mittleren Tidehochwasserstand (MThw) liegen jeweils bei 33,1/34,3 Metern mit Sichtweiten von 16,62/16,83 Seemeilen.
Auf dem Leuchtturm befinden sich auch eine Pegelanlage der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes und eine Wettermessstation des Deutschen Wetterdienstes.
Gestaltung des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel: Prof. Dieter Ziegenfeuter und Susanne Wustmann, Dortmund
Wert: 70 Cent
Text: Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bischof Ulrich von Augsburg

Anlässlich des 1100. Jahrestages seiner Weihe zum Bischof von Augsburg im Jahre 923 und seines 1050. Todestages im Jahre 973 erinnert das Bistum Augsburg im Jubiläumsjahr 2023/24 an das fast 50-jährige Wirken des heiligen Bistums- und Stadtpatrons Ulrich. Der Spross einer alemannischen Adelsfamilie wurde 890 geboren und erlangte in seiner Zeit als Bischof, Reichsfürst und Stadtherr sowohl kirchlich als auch (gesellschafts-)politisch große Bedeutung für die deutsche und europäische Geschichte.
Mit seiner Interpretation des Bischofs Ulrich schuf der Münchner Bildhauer Klaus Backmund (1929-2020) bereits anlässlich der 1000-Jahr-Feier von dessen Heiligsprechung im Jahre 1993 ein beeindruckendes Kunstwerk: Die überlebensgroße Bronze-Skulptur, platziert auf einem polygonalen Sockel an der Eingangsseite des Tagungshauses Sankt Ulrich in direkter, südlicher Nachbarschaft zur Basilika St. Ulrich und Afra – der Grablege des Heiligen –, gehört zu den bekanntesten Darstellungen des Heiligen. In der Tradition u. a. von Josef Henselmann gestaltete Backmund, der von 1949 bis 1955 an der Akademie für Bildende Künste in München sowie an der École des Beaux-Arts in Paris studierte, damit eine charakterstarke und expressive Plastik dieses benediktinisch geprägten Bischofs.
Dabei passt die Dynamik der Heiligenfigur gut in das Gesamtensemble des Tagungshotels, das der Architekt Alexander von Branca (1919-2011) in den Jahren 1971 bis 1974 erbaut hatte: Der heilige Ulrich heißt die Besucher des Hauses willkommen. Seine hagere, um nicht zu sagen „kantige“ Gestalt erinnert an einen asketischen Menschen, der sich der Armen und Schwachen annahm und sich erst dann selbst zum Mahl niedersetzte, wenn sie zuvor Speis und Trank erhalten hatten.
Klaus Backmund widmete sich in seinem Schaffen vorrangig christlichen Themen und wurde vielfach ausgezeichnet. Seine letzte Ruhestätte fand der Künstler auf dem Münchner Nordfriedhof.
Gestaltung des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel:
Professor Peter Krüll, Kranzberg
© Foto: Ulrich Wagner, Augsburg
© Skulptur: Klaus Backmund, München
Wert: 275 Cent
Text: Dr. Christoph Goldt, Bistum Augsburg
„Beliebte Haustiere“ - Hund

Sie sind Beschützer, Arbeitshelfer und Spielgefährten, vor allem in Deutschland auch beste Freunde oder Familienmitglieder: Hunde sind erwiesenermaßen die ältesten Haustiere des Menschen. Seit vielen tausend Jahren begleiten sie uns als treue Gefährten. Statistiken zufolge leben in Deutschland mehr als zehn Millionen Hunde, die in Form und Größe erhebliche Unterschiede aufweisen können. Hierzulande belegen sie Platz zwei der beliebten Haustiere und führen als neues Motiv die gleichnamige Sonderpostwertzeichen-Serie fort, die im Jahr 2023 mit dem Motiv der Katze ihren Anfang nahm.
Haushunde gehören zur Familie der Hunde (Canidae), die sehr anpassungsfähig sind und nahezu alle Lebensräume und Klimazonen der Erde besiedelt haben. Sämtliche Vertreter der Caniden sind wildlebend – bis auf den Haushund, den domestizierten, also zahmen Nachfahren des Wolfs, was sich auch am wissenschaftlichen Namen beider erkennen lässt: Canis lupus wurde zu Canis lupus familiaris. Wann und wo dies geschah, ist allerdings bis heute nicht restlos geklärt. Vieles spricht dafür, dass der Wolf die Nähe des Menschen suchte, um von seinen Resten zu profitieren. Der Mensch wiederum erkannte dessen Potenzial, beim Jagen zu helfen. Als soziale Wesen, die in Gemeinschaften leben, fiel es beiden leicht, sich aufeinander einzulassen.
Zur Kommunikation mit den Menschen haben Hunde eine bemerkenswert differenzierte Lautsprache entwickelt. Mehr als sechstausend Belllaute helfen ihnen dabei, ihre Wünsche, Stimmungen und Gefühle auszudrücken. Darüber hinaus vermag kein anderes Tier die Mimik, Gestik und Tonlage des Menschen so gut zu lesen wie der Hund. Vor allem jene Vierbeiner, die im häuslichen Bereich aufgewachsen sind und dort sozialisiert wurden, verstehen erstaunlich viel und sind zu empathischen Reaktionen fähig. Kein Wunder also, dass sie wie echte Familienmitglieder behandelt werden und eine besondere Rolle einnehmen, die alljährlich am 10. Oktober, dem internationalen Welthundetag, gefeiert wird.
Gestaltung des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel: Thomas Steinacker und Bettina Walter, Bonn
Motiv: © Eric Isselée / Adobe Stock
Wert: 85 Cent
Text: Deutscher Philatelie Service, Wermsdorf
„Für den Umweltschutz“ // Natürlicher Klimaschutz
Intakte Ökosysteme sind natürliche Klimaschützer. Wälder und Auen, Böden und Moore, Meere und Gewässer, naturnahe Grünflächen in der Stadt und auf dem Land binden Kohlendioxid aus der Atmosphäre und speichern es langfristig. Sie wirken zudem als Puffer gegen Klimafolgen, indem sie Hochwasser aufnehmen und bei Hitze für Abkühlung sorgen. Und schließlich erhalten sie unsere Lebensgrundlagen, bieten wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen, speichern Wasser und sind Rückzugsorte für Menschen.
Große Klimaschutzeffekte erfordern oft langfristige Veränderungen. Das gilt zum Beispiel für Moore und Wälder. Sie sind wichtig als Lebensräume für Tiere und Pflanzen, für einen funktionierenden Wasserhaushalt und als Kohlenstoffspeicher. Allein 53 Millionen Tonnen Treibhausgase werden beispielsweise in Deutschland jährlich in die Atmosphäre freigesetzt, weil entwässerte Moorböden ihre Funktionen nicht erfüllen können. Wälder wiederum sind in Deutschland die größte landgebundene Treibhausgas-Senke, sie können Kohlenstoff aus der Atmosphäre dauerhaft einbinden.
Mehr Naturnähe und Diversität bewirkt in Ökosystemen erfahrungsgemäß auch mehr Resilienz, also eine größere Widerstandsfähigkeit gegen destabilisierende äußere Einflüsse, die mit der Klima- und Biodiversitätskrise weiter zunehmen. Wenn wir die Natur in Deutschland dauerhaft erhalten und wiederherstellen wollen, müssen wir ihr jetzt den Raum geben und sie dabei unterstützen, sich zu erholen und fit für die Zukunft zu werden. Und dies visualisiert auch die Umweltmarke 2024 zum Thema „Natürlicher Klimaschutz“, welche einerseits die negativen Folgen eines trockengelegten Moores mit verursachten CO2-Emmissionen und andererseits die positiven Auswirkungen eines wiedervernässten Moores auf das Klima und den Lebensraum von Tieren und Pflanzen zeigt.
Gestaltung des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel: Julia Warbanow, Berlin
Text: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

75 Jahre NATO
Als am 4. April 1949 zwölf Staaten die Nordatlantikvertragsorganisation (North Atlantic Treaty Organization, NATO) gründeten, gab es die Bundesrepublik Deutschland noch nicht. Erst im Jahr 1955 trat die Bundesrepublik als 15. Mitglied der Allianz bei.
In den ersten 40 Jahren des Bestehens der NATO prägte der Ost-West-Konflikt die sicherheitspolitische Lage. Das vorrangige Ziel der Allianz war es, Sicherheit und Souveränität ihrer Mitglieder gegenüber der Sowjetunion zu gewährleisten. Nach Ende des Kalten Krieges folgte eine Phase der Neuausrichtung der Allianz: Ehemalige Mitglieder des Warschauer Paktes beziehungsweise unabhängig gewordene Staaten strebten in die Allianz, viele von ihnen fanden Aufnahme. Mit der Russischen Föderation wurden partnerschaftliche Beziehungen aufgenommen.
Die Jahrzehnte nach Ende des Kalten Kriegs waren zugleich geprägt durch internationales Krisenmanagement – ob auf dem Balkan, im Mittelmeer, im Irak oder in Afghanistan. Mit den Anschlägen des 11. September 2001 wurde erstmals der Bündnisfall nach Artikel 5 des Nordatlantikvertrages ausgelöst. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die sicherheitspolitische Lage in Europa grundlegend verändert. Für die NATO und ihre Mitgliedsstaaten tritt nun die Landes- und Bündnisverteidigung wieder besonders in den Vordergrund.
Aktuell gehören 32 Alliierte zur NATO. Sie stehen in einem System kollektiver Verteidigung füreinander ein und sorgen gemeinsam für Abschreckung und Verteidigung, Krisenprävention und -management, aber auch kooperative Sicherheit. Die NATO ist mehr als ein Militärbündnis. Sie basiert auf gemeinsamen demokratischen Werten und ist seit 75 Jahren ein zentraler Garant für Frieden und Freiheit in Europa.
Gestaltung des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel: Bianca Becker und Peter Kohl, Hamburg
Text: Bundesministerium der Verteidigung

50 Jahre Deutsche Krebshilfe
Am 25. September 1974 gründete Dr. Mildred Scheel die Deutsche Krebshilfe. Seitdem setzt sich die gemeinnützige Organisation maßgeblich für die Interessen krebskranker Menschen und ihrer Angehörigen ein. Nach dem Motto „Helfen. Forschen. Informieren.“ fördert sie Projekte zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung einschließlich der Krebs-Selbsthilfe. Seit ihrem Bestehen hat die Deutsche Krebshilfe entscheidend dazu beigetragen, die Versorgung krebskranker Menschen in Deutschland zu verbessern. Heute können die Hälfte aller erwachsenen Patientinnen und Patienten und 4 von 5 krebskranken Kindern und Jugendlichen geheilt werden. Auch für viele Patientinnen und Patienten, die nicht geheilt werden können, wurde eine Perspektive für ein Leben mit der Erkrankung geschaffen. Vor allem aber ist es ihr gelungen, das Thema Krebs zu enttabuisieren und krebskranken Menschen eine Stimme zu verleihen.
Die Deutsche Krebshilfe ist die bedeutendste private Förderorganisation für die Krebsbekämpfung in Deutschland. Sie unterstützt zahlreiche Forschungsprojekte und stellt Gelder für klinische und wissenschaftliche Strukturmaßnahmen bereit. Zudem fördert sie Krebs-Selbsthilfeorganisationen, steht Betroffenen und Angehörigen mit ihrem telefonischen Informations- und Beratungsdienst INFONETZ KREBS zur Seite und leistet mit ihrem Härtefonds unbürokratische finanzielle Hilfe für Menschen, die durch ihre Krebserkrankung unverschuldet in wirtschaftliche Not geraten sind.
In den vergangenen 50 Jahren hat sich die Deutsche Krebshilfe zu einer bedeutsamen Bürgerbewegung im Kampf gegen den Krebs entwickelt – ganz im Sinn ihrer Gründerin Mildred Scheel. Ohne die langjährige und breite Unterstützung der Bevölkerung – der Spenderinnen und Spender sowie zahlreicher weiterer ehrenamtlich engagierter Menschen, zu denen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Medizin, aber auch Persönlichkeiten aus allen gesellschaftlichen Bereichen zählen – wäre die Arbeit der Deutschen Krebshilfe nicht möglich. Denn sie verfügt über keine öffentlichen Mittel und finanziert ihre gesamten Aktivitäten ausschließlich aus Spenden und freiwilligen Zuwendungen.
Gestaltung des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel: Josie Majetic, Bremen
Foto: © Deutsche Krebshilfe/Konrad Rufus Müller
Text: Deutsche Krebshilfe

„Legenden der Pop-/Rockmusik“ // Freddie Mercury
Freddie Mercury, Mitbegründer, Songschreiber und Leadsänger der britischen Band Queen, ging mit seiner unverwechselbaren Stimme, seiner extrovertierten Bühnenpräsenz und seinen stilistisch vielfältigen Kompositionen als einer der bedeutendsten Rocksänger in die Musikgeschichte ein. Ein Meilenstein seines öffentlichen Wirkens war der spektakuläre zwanzigminütige Gig von Queen beim Live-Aid-Konzert im Londoner Wembley-Stadion von 1985, der oft als bester Live-Auftritt überhaupt gewertet wird. Damals wie heute vereint Freddie Mercury eine riesige Fangemeinde. Nun führt er als zweites Motiv die Sonderpostwertzeichen-Serie „Legenden der Pop-/Rockmusik“ fort.
Geboren als Farrokh Bulsara am 5. September 1946 auf der afrikanischen Insel Sansibar, verbrachte der Sohn indischer Eltern seine ersten Jahre im damaligen britischen Protektorat. 1964 zog die vierköpfige Familie nach London, wo sich Freddie 1966 am Ealing Art College einschrieb und das Studium 1969 mit einem Diplom in Grafikdesign abschloss. 1970 gründete er mit dem Gitarristen Brian May und dem Schlagzeuger Roger Taylor die gemeinsame Band Queen. Der Bassist John Deacon kam 1971 dazu – diese Besetzung blieb zwanzig Jahre bestehen. 1973 veröffentlichte die Band das Debütalbum „Queen“. Der kommerzielle Durchbruch erfolgte 1975 beim vierten Album „A Night At The Opera“.
Zwischen 1979 und 1985 wurde München zur zweiten Heimat für Queen. Vor allem Freddie baute eine starke Bindung zur Isarmetropole auf, wo er seine Homosexualität, zu der er sich nie öffentlich bekannte, unbehelligt ausleben konnte. 1985 zog es ihn zurück nach London, wo er eine Villa im Stadtteil Kensington erwarb. Ein Traum erfüllte sich, als er auf die spanische Opernsängerin Montserrat Caballé traf, die er schon seit Jahren verehrte, und mit ihr das Album „Barcelona“ (1988) produzierte. Am 24. November 1991 verstarb Freddie Mercury im Alter von fünfundvierzig Jahren an einer Lungenentzündung. Die Welt behält ihn als schillernde Ikone der Rockmusik in Erinnerung.
Gestaltung des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel: Jan-Niklas Kröger, Bonn
Foto: © 2024 Mercury Songs Limited. Under License to Bravado Merchandising. All rights reserved.
Text: Deutscher Philatelie Service, Wermsdorf

Briefmarken Dezember 2024



(Ausgabetag: 5. Dezember)
SchUM-Stätten Speyer, Worms und Mainz
Mittelalterliche Zentren des Judentums in Europa
Die SchUM-Stätten Speyer, Worms und Mainz sind Zeugnisse der reichen Geschichte jüdischer Gemeinden in Deutschland und Europa. In den in Speyer, Worms und Mainz entstandenen jüdischen Gemeinden (Kehilot SchUM) erlebte das Judentum in Deutschland seine erste Blütezeit. Als Verbund der SchUM-Gemeinden bildeten die drei Städte am Rhein im Mittelalter das Zentrum des Judentums in Europa. Von der wechselvollen Geschichte der drei Gemeinden erzählen bis heute Bauwerke und Friedhöfe, die zu den ältesten Zeugnissen jüdischen Lebens in Deutschland gehören. Hier entstanden wegweisende Synagogenbauten, Frauenbeträume und Ritualbäder. Die Lehrhäuser der SchUM-Gemeinden brachten große jüdische Gelehrte hervor, die bis heute die jüdische Schriftauslegung prägen. Auch die Takkanot Quellihot SchUM, die Rechtsbestimmungen der SchUM-Gemeinden, wirken, wie es das Beispiel des Briefgeheimnisses zeigt, nicht nur in der jüdischen Rechtsauffassung bis heute nach.
SchUM ist ein Akronym der Anfangsbuchstaben der hebräischen Städtenamen von Speyer, Worms und Mainz:
SchUM-Stätten Speyer, Worms und Mainz
SchUM ist die Wiege des aschkenasischen Judentums. Und Aschkenas ist die aus dem Mittelalter stammende rabbinische Bezeichnung für Mitteleuropa und Deutschland und die dort lebenden Jüdinnen und Juden.
Vor etwa 20 Jahren haben sich Speyer, Worms und Mainz auf den Weg gemacht, ihr umfangreiches und bedeutsames jüdisches Erbe auf der Liste des UNESCO-Welterbes zu verankern. Am 27. Juli 2021 wurden die SchUM-Stätten – der Judenhof in Speyer mit den Resten der ältesten Synagoge Europas, der Frauenschul, der größten und am besten erhaltenen Monumentalmikwe (Ritualbad) und der Jeschiwa (Lehrhaus), der Wormser Synagogenbezirk mit Synagoge, der ältesten Frauenschul, Mikwe, Lehrhaus und dem Tanzhaus sowie die jüdischen Friedhöfe „Heiliger Sand“ in Worms und „Auf dem Judensand“ in Mainz, die die ältesten erhaltenen jüdischen Friedhöfe Europas sind – in die Welterbeliste der UNESCO eingeschrieben und damit ein von den drei Städten und den jüdischen Gemeinden initiiertes Projekt erfolgreich zum Abschluss gebracht.
Gestaltung des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel: Professor Jens Müller, Düsseldorf
Text: Birgit Kita, Geschäftsführerin des SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz e.V. und Welterbekoordinatorin UNESCO-Welterbe SchUM-Stätten Speyer, Worms und Mainz
200 Jahre Weihnachtslied „O Tannenbaum“
Von den Türmen der Stadt Leipzig läuten die Mittagsglocken. Der Mann, der sich seinen Weg durch den Schnee bahnt, tastet mit gestreckter Hand die Mauer entlang. Er ist kurzsichtig! Er hält, klopft sich den Schnee ab und wischt mit dem Mantelärmel über das Messingschild. In schwarzer Gravur ist der Name Ernst Anschütz zu lesen. Darunter: Pädagoge Anschütz, Lehrer der Nikolaischule. Seit Jahren schon und stets glücklich. Aber heute gab es zum ersten Mal Verdruss. Zwischen ihm und dem Rektor kam es zum heftigen Streit. Anschütz betritt sein Zimmer, macht sich am Ofen zu schaffen und öffnet das Fenster, um Rauch abziehen zu lassen. Gegenüber hält ein Pferdeschlitten. Zwei Männer laden Tannenbäume ab. Eine Frau winkt einen der Händler zu sich, deutet auf ein Bäumchen und lässt es sich unter den Arm geben. Sie wird es heimtragen und am Heiligen Abend mit Zuckerwatte behängen – zur Freude der Kinder. Es kommen immer mehr Leute, um Bäume zu kaufen. Anschütz, der unentwegt am Fenster steht, erinnert sich nicht, dass es die Sitte der Christbäume in seiner Kindheit gab. Wie er so versunken schaut, hat er plötzlich das Empfinden, sich einen Christbaum ins Zimmer zu stellen. Er geht über die Straße.
Merkwürdig: Seine Bedrückung ist wie weggeblasen, als seine Finger über die dunkelgrünen Nadelzweige gleiten. Sind diese kräftigen Zweige nicht ein lebendiges Sinnbild der Beständigkeit? Liegt nicht ein weidlicher Trost darin, dass kein Sturm, kein Regen, kein Frost ihnen etwas anhaben kann? Anschütz kauft seinen ersten Christbaum.
In seiner Bibliothek hat er eine Sammlung Volkslieder des Berliner Musikers August Zarnack. Eine Komposition handelt vom Tannenbaum. Seinem Wesen nach ein Liebeslied, aber Anschütz möchte der schönen Melodie etwas Weihnachtliches andichten. Die erste Strophe kann er unverändert beibehalten. Die übrigen wird er umschreiben. Und wie er sitzt und schreibt, bemerkt er kaum, dass er aus dem Probieren mitten ins Vollbringen gerät. Noch vor dem Lichtanzünden ist er fertig. Er setzt seinen Namen unter das Blatt und das Datum: Leipzig, den 19. Dezember 1824.
Dr. Ernst Anschütz wurde 1780 in Goldlauter als Sohn des Ortspfarrers geboren. Sein Theologie-Studium absolvierte Anschütz in Leipzig und blieb anschließend dort. Er schrieb mehrere Kinderbücher, spielte verschiedene Musikinstrumente und komponierte unzählige Kinderlieder, wie auch „O Tannenbaum“.
Gestaltung des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel: Michael Menge, Duisburg
Text: Matthias Gering, Ortsteilbürgermeister Goldlauter-Heidersbach
Sonderpostwertzeichen „75 Jahre Müttergenesungswerk“

Am 31. Januar 1950 gründete Elly Heuss-Knapp, die Frau des ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss, (gemeinsam mit Antonie Nopitsch) das Deutsche Müttergenesungswerk (MGW). Seitdem setzt sich die gemeinnützige Stiftung maßgeblich für die Gesundheit von Müttern und seit 2013 auch von Vätern und pflegenden Angehörigen in Deutschland ein. Unter dem Dach des MGW arbeiten fünf Wohlfahrtsverbände beziehungsweise deren Fachverband/Arbeitsgemeinschaft (AWO, DRK, EVA, KAG, Parität) zusammen. Besonders zeichnet sich das MGW durch ganzheitliche und gendersensible Kurmaßnahmen und das Konzept der Therapeutischen Kette im MGW-Verbund aus. Diese umfasst die kostenlose Beratung der Betroffenen bei fast 900 Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände, die Kurmaßnahme in den über 70 vom MGW anerkannten Kliniken (für Mütter und Mutter-Kind beziehungsweise Väter und Vater-Kind sowie pflegende Angehörige) und die Nachsorgeangebote vor Ort. Alle anerkannten Kliniken tragen das MGW-Qualitätssiegel.
Die Stiftung steht unter der Schirmherrschaft der Frau des Bundespräsidenten Elke Büdenbender. Seit ihrem Bestehen hat die Elly Heuss-Knapp-Stiftung entscheidend dazu beigetragen, die Gesundheit von Sorgearbeitenden in Deutschland zu fördern. Dank des politischen Einsatzes wurden 2002 die Krankenkassen dazu verpflichtet, die Kurmaßnahmen voll zu finanzieren. Mit der Gesundheitsreform 2007 wurden die Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen zu gesetzlichen Pflichtleistungen der Krankenkassen. Heute nehmen jährlich rund 45.000 Mütter, 2.300 Väter und ein kleiner Teil pflegende Angehörige eine Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahme im Müttergenesungswerk wahr. Doch es gibt kein Grund zum Ausruhen: Der Ausbau der Kurplätze ist dringend erforderlich. Derzeit warten 40 Prozent der Kurbedürftigen mit bewilligtem Antrag ein Jahr lang auf den Beginn ihrer Kurmaßnahme.
Das Müttergenesungswerk ist ausschließlich durch Spenden finanziert und benötigt diese u. a. zur Unterstützung einkommensschwacher Mütter und ihrer Kinder beziehungsweise Väter und deren Kinder bei der Durchführung einer Kurmaßnahme, für Beratung und Nachsorgeangebote sowie für Informations- und Aufklärungsarbeit.
Gestaltung des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel: Andrea Voß-Acker, Wuppertal
Wert: 95 Cent
Text: Müttergenesungswerk
Sonderpostwertzeichen „100 Jahre Deutscher Akademischer Austauschdienst“
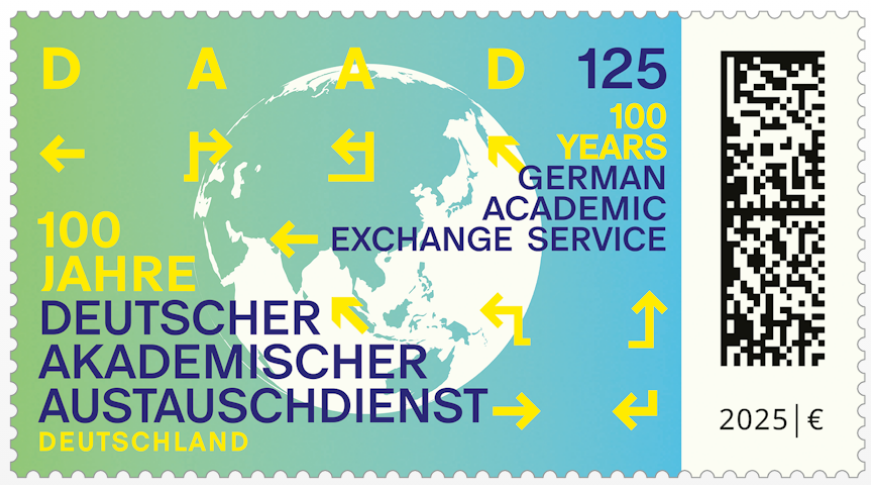
Seit 100 Jahren fördert der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) den internationalen Austausch von Studierenden, Lehrenden und Forschenden sowie die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit.
Den Grundstein hierfür legte Carl Joachim Friedrich, der 1922/23 als Gaststudent aus Heidelberg in New York seine Leidenschaft für internationalen Austausch entdeckte. Zurück in Deutschland organisierte er 1924/25 mit dem amerikanischen „Institute of International Education“ Stipendien für 13 deutsche Kommilitoninnen und Kommilitonen. Hieraus entstand 1925 der Akademische Austauschdienst als Vorläuferorganisation des DAAD. Viele weitere Stipendien folgten: Knapp 3 Millionen Akademikerinnen und Akademiker sowie tausende Hochschulkooperationsprojekte wurden bis heute vom DAAD gefördert.
Friedrich wanderte später in die USA aus, wurde zu einem der angesehensten Politikwissenschaftler seiner Zeit und trug zum demokratischen Neubeginn Deutschlands nach dem 2. Weltkrieg, zur Entwicklung des Marshall-Plans und zur Ausarbeitung des Grundgesetzes bei.
Seine Geschichte steht exemplarisch für die zahlreicher DAAD-Geförderter aus aller Welt, die die transformative Kraft des Austauschs erfahren haben – unter ihnen namhafte Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kunst, Politik, Wirtschaft und Kultur. Ihr Wirken illustriert eindrucksvoll, wie Austausch nicht nur die individuelle Entwicklung fördert, sondern auch bedeutsamen gesellschaftlichen Einfluss ausübt.
Als Verein der deutschen Hochschulen und Studierendenschaften mit über 60 Büros weltweit knüpft der DAAD ein Netzwerk, das die internationale Strahlkraft des deutschen Wissenschaftssystems und den Austausch zwischen Kulturen und Nationen stärkt.
In Zeiten globaler Krisen und geopolitischer Konflikte zeigt sich die Relevanz des DAAD in seiner Fähigkeit, die internationale Wissenschaftsgemeinschaft durch innovative Förderprogramme und vielfältige Aktivitäten effektiv zu stärken. Der Kooperationsraum Wissenschaft ermöglicht Austausch und Zusammenarbeit und ist damit entscheidend für die Bewältigung der drängenden Herausforderungen unserer Zeit.
Gestaltung des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel: Matthias Wittig, Berlin
Wert: 125 Cent
Text: Birgit Michels, Projektleitung 100 Jahre DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst
Sonderpostwertzeichen „125 Jahre Bürgerliches Gesetzbuch - BGB“

Am 1. Januar 1900 trat das Bürgerliche Gesetzbuch in Kraft, mit dem das bürgerliche Recht vereinheitlicht wurde, das die Rechte und Pflichten zwischen den gleichberechtigten Menschen und anderen Privatrechtssubjekten regelt. Damit endete die Rechtszersplitterung im Deutschen Reich von 1871, die Industrie, Handel und Verkehr erheblich erschwerte.
Das Bürgerliche Gesetzbuch war ein Kind seiner Zeit, dessen Sprache und Regelungstechnik von der Rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts geprägt ist. Es enthält dem System der Pandektenwissenschaft folgend fünf Bücher. Das erste Buch enthält den Allgemeinen Teil, in dem Regelungen zu Personenrecht, allgemeine Regelungen zu Rechtsgeschäften, zu Fristen und zur Verjährung getroffen werden. Im zweiten Buch ist das Recht der Schuldverhältnisse geregelt. Das dritte Buch enthält das Sachenrecht. Im vierten Buch ist das Familienrecht und im fünften Buch das Erbrecht enthalten.
Im Bürgerlichen Gesetzbuch befinden sich auch 125 Jahre nach seinem Inkrafttreten noch die zentralen Vorschriften des bürgerlichen Rechts, die die Rechtsverhältnisse der Bürgerinnen und Bürger untereinander bestimmen, ohne dass die Meisten die einzelnen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs genauer kennen.
Die lange Geltungsdauer des Gesetzes war nur möglich, weil es in den 125 Jahren seines Bestehens durch den Gesetzgeber und die Rechtsprechung stetig fortentwickelt wurde, um es an den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel anzupassen, was bisher immer wieder gelungen ist. Vor allem das Familienrecht und das Schuldrecht wurden unter dem Einfluss des Grundgesetzes und des europäischen Rechts erheblich verändert. Das Familienrecht erfuhr seit 1945 tiefgreifende Reformen, wodurch die Rechtstellung von Frauen, Kindern und gleichgeschlechtlichen Paaren erheblich verändert wurde. Das Schuldrecht wurde sozialer, indem zahlreiche Regelungen zum Schutz schwächerer Vertragspartner, insbesondere zum Schutz von Verbrauchern geschaffen wurden. Viele dieser neuen schuldrechtlichen Regelungen gehen auf europäische Richtlinien zurück, so dass das Bürgerliche Gesetzbuch insoweit auch zur europäischen Rechtsvereinheitlichung beiträgt.
Gestaltung des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel: David Fischbach, Wuppertal
Wert: 95 Cent
Text: Bundesministerium der Justiz
Sonderpostwertzeichen-Serie „U-Bahn-Stationen“
Bochum Rathaus Süd

Die neunte und gleichzeitig letzte Briefmarke der Sonderpostwertzeichen-Serie „U-Bahn-Stationen“ zeigt einen Ausschnitt der im Jahr 2006 als Teil der Bochumer Stadtbahn eröffneten unterirdischen Haltestelle Rathaus Süd. Sie liegt zentral in der Bochumer Innenstadt und gehört zur Station Bochum Rathaus, die aus drei in einem rechtwinkligen Dreieck angeordneten Anlagen besteht. Neben der weitläufigen Halle mit ihrer farbigen Beleuchtung, die den Passagieren das Gefühl von Sicherheit und Transparenz vermittelt, fallen der gläserne Schrägaufzug sowie die ebenfalls verglaste Brücke ins Auge, welche als Strecke einer anderen Straßenbahnlinie den Luftraum der Station quert und in Deutschland einzigartig ist. Für eine optische Verbindung zur Oberfläche sorgen dreizehn in die Faltwerkdecke eingelassene, prismenförmige Tageslichtöffnungen.
Wegen ihrer außergewöhnlichen Architektur wurde die Station mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter der Renault Traffic Design Award und der Architekturpreis Bochum, beide im Jahr 2006, sowie der Architekturpreis Nordrhein-Westfalen im Jahr 2007.
Entwurf des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel: Chayenn Gutowski, Bonn
Foto: © Stadt Bochum: André Grabowski
Wert: 110 Cent
Text: Deutscher Philatelie Service, Wermsdorf
Sonderpostwertzeichen-Serie „Sehenswürdigkeiten in Deutschland“ - Rakotzbrücke

Die sechste Briefmarke der Sonderpostwertzeichen-Serie „Sehenswürdigkeiten in Deutschland“ zeigt eines der schönsten Ausflugsziele in Sachsen: die im Landkreis Görlitz im Azaleen- und Rhododendronpark Kromlau gelegene Rakotzbrücke, welche wegen ihrer außergewöhnlichen Architektur zu den Wahrzeichen der Lausitz gehört. Durch die Spiegelung im Rakotzsee entsteht ein beeindruckender visueller Effekt, der den anmutigen Bogen der Rakotzbrücke als perfekten Kreis erscheinen lässt. Im Volksmund wird die im 19. Jahrhundert auf Veranlassung des Gutsbesitzers Herrmann Friedrich Roetschke (1805–1893) aus Basaltsteinen errichtete Brücke auch als Teufelsbrücke bezeichnet. Im hinteren Bereich ist die sogenannte Basaltorgel, ein an die Formen der Natur angelehntes Kunstwerk, zu sehen.
Dafür, dass die Rakotzbrücke weit über Deutschland hinaus bekannt ist, haben nicht zuletzt der deutsche Märchenfilm „Der Zauberlehrling“ (2017) und der US-amerikanische Science-Fiction-Actionfilm „Matrix Resurrections“ (2021) gesorgt, in denen sie als magisches Tor beziehungsweise als Kulisse für eine Kampfsimulation fungiert.
Entwurf des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel: Chayenn Gutowski, Bonn
Foto: © Mike Mareen / Shutterstock
Wert: 95 Cent
Text: Deutscher Philatelie Service, Wermsdorf
Sonderpostwertzeichen „Spieltiere“

Kinder lassen im freien Spiel ihrer Kreativität freien Lauf, um die tagtäglich erlebten Eindrücke zu verarbeiten. Als besonders anregendes Spielzeug werden die naturnahen Spielfiguren der Firma Schleich wahrgenommen. Der Grundstein für die heute so authentischen Figuren wurde mit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1935 gelegt. Um diese neunzig Jahre des fantasiereichen Spielens zu würdigen, erscheint das in Kooperation mit Schleich entstandene Sonderpostwertzeichen „Spieltiere“.
Der Markenrelaunch 2022 zielt darauf ab, eine international bekannte „Love Brand“ zu werden. Dazu gehört auch das Thema Nachhaltigkeit. Die weltweit ersten Spielfiguren, die komplett recycelt werden können, ohne die gewohnte Qualität zu verlieren, sind seit 2024 erhältlich: eine Schildkröte, ein Bonobo und ein Löwe. Letzterer ist neben zwei älteren Exemplaren seiner Gattung auf dem Sonderpostwertzeichen „Spieltiere“ zu sehen. Alle der sogenannten Cradle to Cradle Certified® Bronze Figuren können fortan in den Produktkreislauf zurückkehren und in neuer Form wiederauferstehen.
Entwurf des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel: Chayenn Gutowski, Bonn
Bildrechte: © Schleich GmbH
Wert: 95 Cent
Text: Deutscher Philatelie Service, Wermsdorf
Âû çäåñü » Ôîðóì ôèëàòåëèñòîâ (Òåìàòè÷åñêàÿ ôèëàòåëèÿ è Ìèð) ÔÈËÔÎÐÓÌ » Briefmarken / Auf deutsch » Deutsches Briefmarken